Wie entstand die Europäische Union?
Auf einen Blick
- Die Europäische Union wurde gegründet, um den Frieden in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu sichern
- Die Mitgliedsstaaten geben Macht an das EU-Parlament ab, dies bedeutet jedoch nicht, dass Entscheidungen gänzlich ohne die Zustimmung der Mitgliedstaaten getroffen werden können
- Demokratische Grundprinzipien sind im EU-Vertrag festgeschrieben
Im Bild
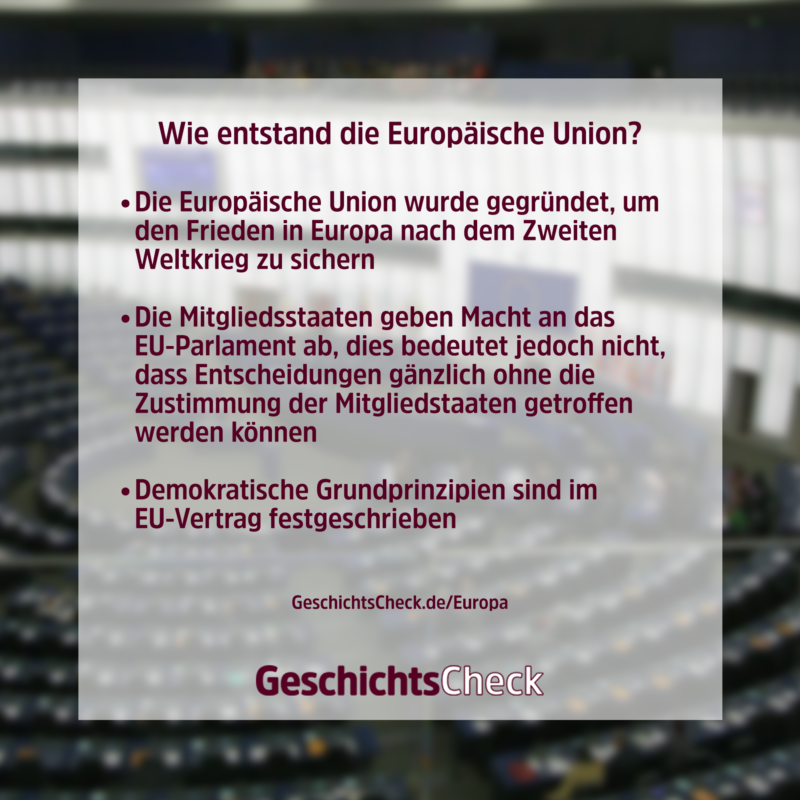
jeffowenphotos, Hemicycle of Louise Weiss building of the European Parliament, Strasbourg, Crop, Blur, Text von GeschichtsCheck, CC BY 2.0
Lesestoff
Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und der anhaltenden Spannung zwischen Ost und West blieb die Frage nach der Erhaltung eines dauerhaften Friedens in Europa. Winston Churchill rief bereits im Juni 1946 zur Gründung der Vereinigten Staaten von Europa auf. Besonders die westlichen Staaten Europas stellten sich die Frage, wie sie ihre eigene Position stärken konnten – im beginnenden Ost-West-Konflikt ging es hier besonders darum, einen Gegenpol zur Sowjetunion zu bilden. Zudem blieb die Frage, wie man Deutschland – hier vor allem Westdeutschland – in die neue europäische Ordnung integrieren wollte und konnte.1
Bereits der Marshallplan führte dazu, dass sich die beteiligten europäischen Länder verpflichteten, wirtschaftlich zusammenzuarbeiten, an dieser Stelle fand bereits ein Ausschluss der osteuropäischen Staaten statt, da die Sowjetunion am 2. Juli 1947 das Angebot zur Beteiligung am Marshallplan ablehnte, sie wollte eine Einmischung der USA in die Souveränität der europäischen Staaten verhindern.2 Eine Ausnahme bildet in diesem Fall Jugoslawien, es erhielt 1950 die erste Unterstützung durch die USA. Am 5. Mai 1949 wurde durch zehn europäische Staaten der Europarat gegründet. Dieser Zusammenschluss hatte schon damals, ebenso wie heute, das Ziel, Demokratie, Frieden und den Wohlstand in Europa zu sichern und zu fördern. Erreicht werden sollte dies durch eine enge Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten; eine Souveränitätsübertragung auf den Europarat wurde jedoch durch die Mitgliedsstaaten abgelehnt.3
Am 9. Mai 1950 machte der französische Außenminister Robert Schuman auf einer Pressekonferenz den Vorschlag, die französische und deutsche Kohle- und Stahlproduktion unter eine gemeinsame Aufsichtsbehörde zu stellen – den „Schuman-Plan“. Die anderen europäischen Länder sollten dazu aufgefordert werden, sich dieser Vereinigung anzuschließen. Diese Zusammenlegung sollte sowohl den Lebensstandard in Frankreich und Deutschland heben als auch die Rüstungsindustrie kontrollieren und damit den Frieden in Europa sichern.4 Die Verbindung der deutsch-französischen Kohle- und Stahlindustrie führte 1951 zur Entstehung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). Hier schlossen sich Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg zusammen.5
Der seit Sommer 1950 herrschende Koreakrieg und die damit beginnenden Diskussionen um eine deutsche Wiederbewaffnung brachten ein weiteres europäisches Projekt auf den Plan – die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG). Die Pläne einer deutschen Wiederbewaffnung lösten besonders in Frankreich Besorgnis aus – immerhin waren seit dem Zweiten Weltkrieg erst fünf Jahre vergangen. Die Außenminister-Konferenz im September 1950 in Washington zeigte, dass Frankreich in der Frage einer deutschen Wiederbewaffnung in die Isolation geraten war. Damit Frankreich nicht weiter ins Hintertreffen geriet, schlug der französische Ministerpräsident Pleven im Oktober 1950 eine europäische Verteidigungsgemeinschaft vor, auch hier sollte die supranationale Methode aus der EGKS angewandt werden. Die Verhandlungen waren insofern erfolgreich, als das ein EVG-Vertrag aufgesetzt wurde, der die Errichtung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft mit einer Armee unter gemeinsamen Kommando vorsah. Trotzdem scheiterte die EVG, da die neue Regierung in Frankreich unter Mendès France die Ratifizierung ablehnte, damit galt die EVG als gescheitert.6
1957/58 gründeten Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), aus der 1993 − mit Inkrafttreten des 1992 unterzeichneten Vertrags von Maastricht − die Europäische Gemeinschaft (EG) hervorging. In der abschließenden gemeinsamen Bestimmung des Vertrags wurde gelichzeitig die Europäische Union konstituiert, die als weitere Stufe der immer enger werdenden Zusammenarbeit der europäischen Staaten präsentiert wurde. Die Zusammenarbeit der Länder wurde auch in den Bereichen Justitz-, Innen-, Außen- und Sicherheitspolitik unter dem Dach der Europäischen Union (EU) ausgeweitet.7 Der immer weitere Zusammenschluss der Nationalstaaten führte dazu, dass immer mehr nationalstaatliche Macht an das Europaparlament abgegeben wurde, dieses Phänomen wird als Supranationalität bezeichnet. Die Abgabe nationalstaatlicher Macht im Zuge der Zusammenarbeit war und ist auch mit Skepsis, Angst und Kritik verbunden. Alle drei Aspekte werden besonders dadurch ausgelöst, dass die Nationalstaaten Angst vor Souveränitäts- und damit Kompetenzverlust haben. Dieses Dilemma zwischen Abgabe von Kompetenzen an das Europaparlament und dem Gewinn der staatlichen Zusammenarbeit hat nie nur Vor- oder Nachteile und besteht bereits seit den Anfängen der EU. EU-Skeptiker*innen schätzen jedoch den Verlust der Souveränität als schwerwiegender ein als den Gewinn aus der europäischen Zusammenarbeit. Neben der Befürchtung, die nationale Souveränität zu verlieren, gibt es auch die Sorge, dass die eigene Identität eingeschränkt oder durch die der anderen Mitgliedsstaaten überlagert wird.8 Dem liegt aber meist eine stark national ausgerichtete Identität zugrunde.
Ein Vorwurf, der gegenüber der EU-Struktur immer wieder erhoben wird, ist der eines Demokratiedefizits. Dieser ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Die EU definiert sich als Wertegemeinschaft, in welcher der Schutz von Minderheiten und Menschenwürde festgeschrieben ist. Das EU-Parlament wird zwar direkt gewählt, trotzdem werden, bedingt durch die Gewaltenteilung, nicht alle Entscheidungen durch dieses Parlament gefällt. Insbesondere wird hier die stärkere Stellung des Europarats gegenüber dem Europaparlament kritisiert. Dass das EU-Parlament nicht über die volle Entscheidungsgewalt verfügt, liegt ebenfalls daran, dass die Nationalstaaten nicht alle Macht an das EU-Parlament abgegeben haben und damit auch an der weiterhin starken Stellung der Nationalstaaten. Trotzdem sind im EU-Vertrag demokratische Strukturen festgeschrieben und werden vom europäischen Gerichtshof auf ihre Einhaltung hin überprüft.9
Zum Abschluss ist zu sagen, dass das kritische Abwägen der Vor- und Nachteile der Machtabgabe an das EU-Parlament Teil des demokratischen Prozesses ist; ohne diese Abgabe lässt sich aber auch oben beschriebenes Demokratiedefizit nicht lösen. Ebenso sollte der Nutzen aus der europäischen Zusammenarbeit dabei nicht außer Acht gelassen werden.
- Eckart D. Stratenschulte: Gründung der Europäischen Gemeinschaft, April 2014, http://www.bpb.de/internationales/europa/europaeische-union/42989/europaeische-gemeinschaften?p=all [31.10.2016]. [↩]
- Der neue Fischer Weltalmanach, Chronik Deutschland 1949-2014. 65 Jahre deutsche Geschichte im Überblick, (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung Bd. 1488), Frankfurt am Main 2014, S. 9. [↩]
- Eckart D. Stratenschulte: Gründung der Europäischen Gemeinschaft, April 2014, http://www.bpb.de/internationales/europa/europaeische-union/42989/europaeische-gemeinschaften?p=all [31.10.2016]. [↩]
- Franz Knipping: Rom, 25. März 1957. Die Einigung Europas (20 Tage im 20. Jahrhundert), München 2004, S. 59 f. [↩]
- Ebd., S. 66. [↩]
- Ebd., S. 74-79. [↩]
- Zukunft Europa, Geschichte der EU, http://www.zukunfteuropa.at/site/4664/default.aspx [02.11.2016]; Knipping, S. 256. [↩]
- Timm Beichelt: EU-Skepsis als Aneignung europäischer Politik, in: Berliner Debatte Initial 21 (2010) 2, S. 8 f. [↩]
- Matthias Klein: Ist die Europäische Union demokratisch genug?, April 2014 https://www.bpb.de/dialog/europawahlblog-2014/181851/ist-die-europaeische-union-demokratisch-genug [03.11.3016]; http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/176780/demokratiedefizit [13.11.2016]. [↩]
