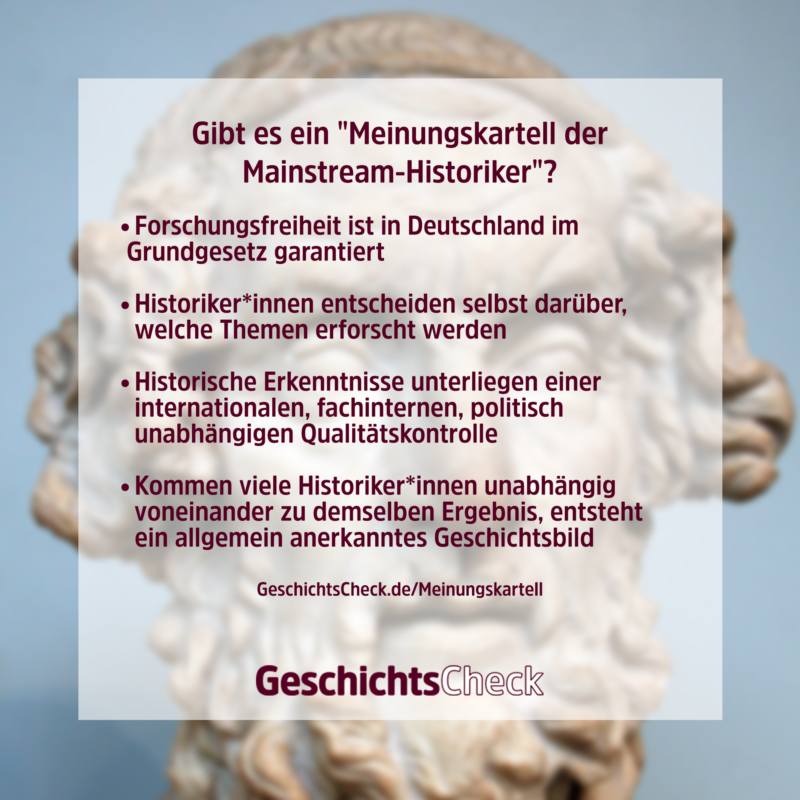Gibt es ein „Meinungskartell der Mainstream-Historiker“?
Auf einen Blick:
- Forschungsfreiheit ist in Deutschland im Grundgesetz garantiert
- Historiker*innen entscheiden selbst darüber, welche Themen erforscht werden
- Historische Erkenntnisse unterliegen einer internationalen, fachinternen, politisch unabhängigen Qualitätskontrolle
- Kommen viele Historiker*innen unabhängig voneinander zu demselben Ergebnis, entsteht ein allgemein anerkanntes Geschichtsbild
Im Bild
Lesestoff:
Historische Forschung wird immer öfter zum Politikum, besonders dann, wenn sie sich mit Themen beschäftigt, die eine Verbindung zu aktuellen Debatten haben. Wenn solche Erkenntnisse von Historiker*innen in den Medien vorgestellt werden und nicht der Meinung des Publikums entsprechen, wird mitunter der Vorwurf laut, es gäbe ein „Meinungskartell der Mainstream-Historiker“. Damit ist gemeint, dass bestimmte, direkt oder indirekt von der Regierung beeinflusste Forscher verfälschte Ergebnisse präsentieren würden, um die Meinung der Öffentlichkeit in eine regierungsfreundliche Richtung zu beeinflussen. Zugleich würde im Rahmen dieser „systematischen Geschichtsfälschung“ die „Wahrheit“ geheim gehalten oder verdreht. Was ist dran an diesem Vorwurf?
Ausbildung und Beruf von Historiker*innen
Es gibt über 600 historische Institute an den deutschen Universitäten und über 300 Forschungsinstitute und Akademien zu historischen Themen. Zusammen mit den freien Historiker*innen dürften damit über 10.000 Personen zur Gruppe der hauptberuflich tätigen Geschichtswissenschaftler*innen zählen. Rechnet man auch Archäolog*innen hinzu, die sich ebenfalls hauptberuflich mit der Erforschung der Vergangenheit beschäftigen, kommen noch einmal über 100 Institute an Universitäten, 17 archäologische Landesämter, zahlreiche Grabungsfirmen sowie das Deutsche Archäologische Institut hinzu. Sie alle beschäftigen zusammen wahrscheinlich mehr als 3.000 Forscher*innen. Schließlich gib es ca. 4.500 historische, kulturhistorische und archäologische Museen mit jeweils mehreren wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen. Es ist also anzunehmen, dass allein in Deutschland mindestens 20.000 Menschen in der Erforschung der Vergangenheit ausgebildet und tätig sind.
Ob man Historiker*in werden möchte und worauf man sich spezialisiert, bleibt dabei jedem selbst überlassen. Jede*r mit Abitur hat die Möglichkeit, Geschichte zu studieren, an den meisten Universitäten sogar ohne Numerus clausus. Es gibt heute, im Gegensatz beispielsweise zur Situation in der DDR1, keine übergeordnete staatliche Instanz, die darüber entscheidet, wer Historiker*in werden darf.
Forschungsthemen und -finanzierung
Und wer entscheidet wozu man forschen darf, wer prüft die Ergebnisse? In Artikel 5, Absatz 3 des Grundgesetzes ist festgehalten, dass die Wissenschaft frei von staatlicher Einmischung ist. Dieser Artikel wurde eingeführt, um staatlich verordnete und kontrollierte Forschung zu verhindern, wie sie beispielsweise in der NS-Zeit stattfand, um die Ideologie des Regimes zu untermauern2. Er besagt, dass der Staat zwar Universitäten und Projektforschung über sogenannte Drittmittel finanziert. Er darf allerdings nicht darüber bestimmen, für welche Themen oder gar Ergebnisse diese Gelder zur Verfügung gestellt werden.
Das bedeutet, dass Historiker*innen selbst entscheiden, welchen der unendlich vielen möglichen Fragen an die Vergangenheit sie nachgehen. Da es aber nur eine begrenzte Anzahl an (oft befristeten) Stellen für Historiker*innen gibt und die Forschungsprojekte teils sehr umfangreich sind, ist die Abhängigkeit von externer Finanzierung groß. Benötigt man solche Gelder, zum Beispiel für zusätzliche Wissenschaftler*innen oder für Reisekosten in Archive, kann man sich für diese bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), bei der EU oder bei Stiftungen bewerben3. Dabei muss die Forschungsfreiheit ebenfalls gewährleistet bleiben. Deshalb entscheiden nicht Politiker*innen, welche Themen Gelder erhalten, sondern wissenschaftliche Gremien, die mit Forscher*innen desselben Bereichs besetzt sind und die Relevanz des Themas und die Qualität der Methodik bewerten. Die Relevanz kann dabei aber durchaus von aktuellen gesellschaftlichen „Trends“ abhängen, die historisch eingeordnet werden sollen. Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, finanzielle Mittel zu bekommen, und wirken sich damit die Wahl der Forschungsfragen aus. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass deren Ergebnisse politisch beeinflusst wären.
Wissenschaftliche Qualitätskontrolle
Arbeitsprozesse und Forschungsergebnisse werden anschließend durch eine innerakademische Selbstkontrolle geprüft4. Geschichtswissenschaft agiert heute, wie die meisten anderen Forschungsdisziplinen, über nationale und politische Grenzen hinweg. Veröffentlicht etwa ein Historiker einen Artikel oder ein Buch mit seinen neuesten Erkenntnissen, wird dieses von internationalen Expert*innen derselben Disziplin auf seine Qualität und Unabhängigkeit bewertet5. Diese regulierende Einflussnahme durch Kolleg*innen wirkt sich auf das Ansehen des Historikers aus. Da sie international geschieht, muss die Forschung des Historikers unabhängig von nationaler Politik sein, wenn er seinen Ruf und seine Karriere nicht gefährden will.
Diese Kontrolle ist ein zentraler Grund dafür, dass es keinen einförmigen geschichtswissenschaftlichen Mainstream gibt. Historiker*innen streiten sich, haben abweichende Meinungen und nehmen einmal geschaffenes Wissen nicht als gegeben hin, sondern müssen offen für abweichende Erkenntnisse etwa aus neuen Quellen bleiben. Solche neuen Befunde müssen dann wiederum der Überprüfung durch die wissenschaftliche Community standhalten. Diskussionen hierzu können Historiker*innen im Rahmen der Meinungsfreiheit überall und jederzeit äußern. Sie sind aber nur selten Thema der medialen Berichterstattung – wie beispielsweise im Fall des sogenannten Historikerstreits. Zum einen, weil es dabei oft um Details geht, deren Einschätzung ein erhebliches Vorwissen benötigt. Und zum anderen präsentieren die Medien meist nur „fertige“ Forschungsergebnisse, aber nicht den Weg dorthin. Den Wettstreit um Sichtbarkeit und Anerkennung der eigenen Forschung „gewinnen“ dabei meist diejenigen Erkenntnisse, die stichhaltig belegt werden können.
Mainstream-Geschichte
Schaut man sich nun an, welches Bild von vergangenen Gesellschaften die Forschung vertritt, könnte man dieses durchaus als „Mainstream“ verstehen. Er entsteht aber nicht durch staatliche Einflussnahme oder ideologische Vereinheitlichung, sondern weil die meisten Ergebnisse vielfach geprüft und miteinander abgeglichen werden, sodass am Ende ein wissenschaftlicher Konsens zustande kommt. Zudem haben natürlich auch Historiker*innen, wie Journalist*innen, politische Meinungen und müssen darauf achten, dass sich diese nicht ihre Ergebnisse beeinflussen. Sollte das doch passieren, fördert die stetige kritische Betrachtung von deren Arbeit dies schnell zu Tage.
Die Strukturen der deutschen und internationalen Wissenschaftslandschaft und deren Qualitätskontrollen verhindern also einen politisch beeinflussten historischen Mainstream. Das negative Bild eines „Meinungskartells der Historiker“ ist vielmehr psychologisch zu erklären: Bei wissenschaftlichen Themen, die sie selbst nicht betreffen, vertrauen die Menschen den betreffenden Forscher*innen und ihrer Expertise. Geht es jedoch um Themen, zu denen man eine persönliche Verbindung hat – etwa zu historischen Themen, die das eigene politische Weltbild betreffen – hinterfragt man die persönliche Einstellung der dahinter stehenden Wissenschaftler*innen und gleicht sie mit der eigenen Haltung ab. Stimmen beide nicht überein, geht man automatisch davon aus, dass die Meinung des vermeintlichen Experten verfälscht sein muss6 – sonst müsste man sein eigenes Weltbild und damit seine Identität in Frage stellen. Das ist wesentlich schwieriger.
- Informationen dazu bietet u.a. die Konrad Adenauer Stiftung. Vgl. auch das DDR-Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 25. Februar 1965. [↩]
- Rüdiger vom Bruch; Brigitte Kaderas (Hg.): Wissenschaften und Wissenschaftspolitik. Bestandsaufnahme zu Formationen, Brüchen und Kontinuitäten im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Stuttgart 2002. Michael Grüttner; John Connelly (Hg.): Zwischen Autonomie und Anpassung. Universitäten in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Paderborn 2003. Jörg Tröger (Hg.): Hochschule und Wissenschaft im Dritten Reich. Frankfurt 1984. [↩]
- Die DFG regelt das in ihrer Satzung. [↩]
- Interview mit Prof. Dr. Martin Reinhart vom Institut für Qualitätssicherung in der Wissenschaft, KM Magazin 07/2014, S. 9-12. [↩]
- Martin Lengwiler: Praxisbuch Geschichte: Einführung in die historischen Methoden, Stuttgart 2010. [↩]
- Dieses Phänomen wird vom Psychologen und Wirtschaftswissenschaftler Per Espen Stoknes in der Folge „The Climate Paradox“ des psychologischen Podcasts „You are not so smart“ erklärt. [↩]